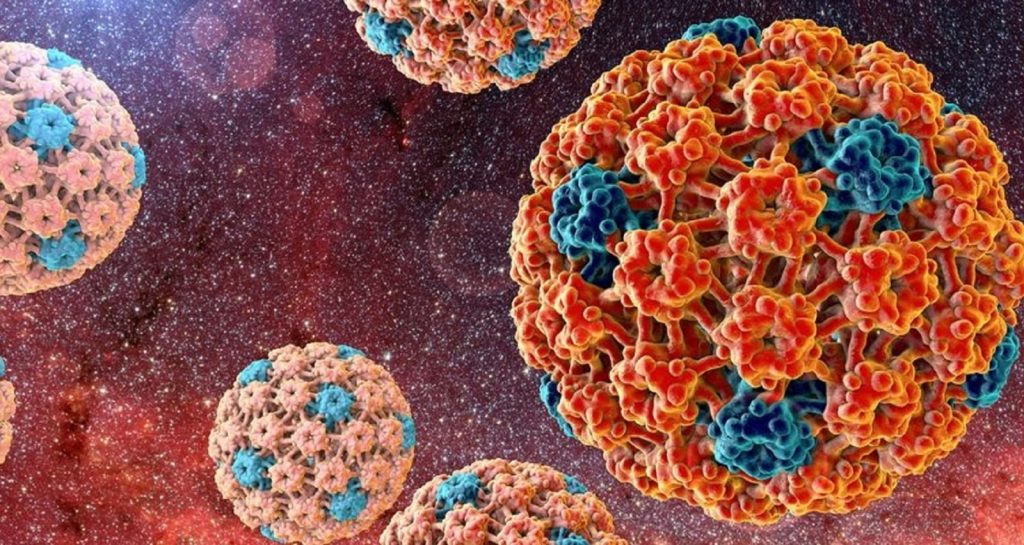
Hautkrebs: Anzeichen, Symptome, Therapie und Heilungschancen
In diesem Beitrag finden Sie eine Übersicht zu den häufigsten Hautkrebsarten, zu deren Anzeichen, Symptomen, Therapieoptionen und Heilungschancen.
Der Begriff „Hautkrebs“ fasst das malignen Melanoms (den schwarzen Hautkrebs) und auch alle Unterformen des weißen Hautkrebses, bzw. des hellen Hautkrebses (unter anderem das sehr häufige Basaliom, das Spinaliom oder die aktinische Keratose) zusammen.
Das unterschiedliche Erscheinungsbild der Krebsformen ergibt sich daraus, dass der Ursprung von verschiedenen Zellen ausgeht. Die entartete Zellart entscheidet über Farbe, Form und Stärke der Malignität (also die Bösartigkeit des Tumors).
Ursache
Die Ursachen für die verschiedenen Tumorarten sind teilweise völlig unterschiedlich. Vor allem Sonnenbrände in der Kindheit werden als Verursacher für die verschiedenen Hautkrebsarten genannt.
Aber auch das „Sonnenbaden“ im Urlaub und Solarium-Besuche sollen verantwortlich sein.
Generell lang andauernde oder intensive Sonneneinstrahlungverantwortlich zu machen, scheint jedoch unangebracht. Offensichtlich verursacht die Insolation nur die weniger bedrohlichen Formen der variantenreichen Erkrankung. Der besonders gefährliche schwarze Hautkrebs (Melanom) ist wahrscheinlich ganz anderen Ursachen zuzuordnen: Die (überraschende) Ursache für den schwarzen Hautkrebs.
Welche Faktoren in der Krankheitsentstehung vielmehr eine Rolle spielen, zeigen Studienergebnisse aus dem “British Journal of Dermatology” (Melanoma epidemic: a midsummer night’s dream?).
Demnach müssen die UV-Strahlen bestenfalls als Sündenbock herhalten. Tatsächlich ist der steile Anstieg einer harmlosen Hautläsion zuzurechnen.
Eine wissenschaftliche Untersuchung japanischer Forscher von 2016 stellt einen Zusammenhang zwischen Druckbelastung und kleinen Hautverletzungen her, die offensichtlich an der Entstehung der Melanome beteiligt sind. Untersucht wurde die Häufigkeitsverteilung von Melanomen auf der Fußsohle. 40 % der malignen Tumore befanden sich auf der hinteren Fußunterseite, wo nicht nur der stärkste Druck wirkt, sondern auch Hautläsionen am häufigsten sind. Nur 26 % der Melanome traten auf der Sohle des Vorfußes auf und 11 % im mittleren Areal der Sohle. Unter dem Fußgewölbe, wo praktisch gar kein Druck lastet, befanden sich nur 2,4 % aller Fußsohlen-Melanome. Die Forscher identifizierten daraufhin mechanischen Druck und Haut-Läsionen als Ursache des schwarzen Hautkrebses (Melanomas and Mechanical Stress Points on the Plantar Surface of the Foot).
Während der Forschungsperiode zwischen 1991 und 2004 wurden etwa 4000 Hautkrebsfälle als Melanom klassifiziert. Das wäre ein Anstieg von 9,39 auf 13,92 statistische Fälle je 100.000 Menschen im Jahr. Die Forscher bezogen dies nicht auf vermehrte Sonneneinstrahlung, sondern auf die Diagnose-Kriterien. Anscheinend wurden nicht krebsverdächtige Hautveränderungen als Melanome im ersten Stadium diagnostiziert.
Die Forscher merkten an, dass die Verteilung der gemeldeten Läsionen nicht mit den Stellen übereinstimme, die üblicherweise der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Ihr Schluss lautete: Es bedürfe besserer Diagnosemethoden und einer Überprüfung der Behandlung von nicht krebsverdächtigen Frühstadien, um sie nicht als bösartige Melanome einzustufen. Außerdem müsse die Rolle ultravioletter Strahlung und geeigneter Schutzmaßnahmen neu bewertet werden. Die Ursachen der Melanomentstehung müssten überprüft werden.
Trotz Negativpresse gäbe es keine Beweise, dass UV-Strahlung Hautkrebs auslöse. Es gäbe vielmehr Beweise für das Gegenteil. Verschiedene Studien der vergangenen Jahre belegten, dass die Häufigkeit von Melanomen mit höherer Sonneneinstrahlung sinke, mit Sonnenschutz aber gesteigert werde. Eine wahre Epidemie von Melanomen sei unter Büroangestellten festgestellt worden, die wenig Sonnenbestrahlung ausgesetzt seien. Erklärt wird dieses Phänomen mit der Art der UV-Exposition. UVA-Strahlen können Fensterscheiben passieren, Vitamin-D-bildende UVB-Strahlung hingegen nicht.
UVA-Strahlen dringen aber tiefer in die Haut ein und sind insgesamt schädlicher. Eine Studie in “Medical Hypotheses” (Increased UVA exposures and decreased cutaneous Vitamin D3 levels may be responsible for the increasing incidence of melanoma) vermutete, das Vorkommen von Melanomen bei Büroangestellten könne wegen des Mangels an Vitamin D und UVB-Strahlung höher sein. Mit Vitamin D könne man folglich Hautkrebs verhindern. Im Blut wird das Vitamin zu Calcitrol verwandelt, einem natürlichen Krebsblocker. Mehr als 200 epidemiologische Studien haben die Krebs verhindernde Wirkung von Vitamin D bei verschiedenen Krebsarten nachgewiesen.
Der logische Schluss von zahlreichen Forschern ist es, dass höhere Vitamin-D-Level im Blut mehrere Krebsarten verhindern könnten. Entgegen herkömmlicher Ansichten ist gerade die Mittagszeit die beste, um die Bildung von Vitamin D durch Sonneneinwirkung zu steigern und die Risiken für die Bildung von Melanomen zu senken. Zu dieser Tageszeit bildet man in kurzer Zeit das meiste Vitamin D. Alternativ dazu ist Vitamin D3 in Kapselform anzuraten, obwohl Sonnenlicht meiner Meinung nach vorzuziehen ist.
Selbstverständlich sollte aber klar sein, dass Sonnenbrände schädlich sind, ebenso wie ein “zu viel” in der Sonne.
Übrigens: Wenn Sie so etwas interessiert, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Newsletter
„Hoffnung bei Krebs“ dazu an:
Symptome bei Hautkrebs
Spezifische Symptome sind selten. Meistens wird der Tumor vom Betroffenen selbst, dessen Umfeld (z.B. durch den Partner) oder von einem Arzt entdeckt. Die Diagnose wird in der Regel dann auch klinisch gestellt. So ist für das geschulte Auge der Hautbefund meist so eindeutig, dass es sich um eine Blickdiagnose handelt. Umso wichtiger wird eine regelmäßige Teilnahme an den sogenannten Screeningprogrammen der gesetzlichen Krankenkassen angeraten.
Alle gesetzlichen Krankenkassen bieten ein vollständiges Hautscreening bei einem Facharzt für Hautkrankheiten (Dermatologe) oder bei einem entsprechend weitergebildeten Hausarzt ab dem 35. Lebensjahr an. Dieses Screening kann dann alle zwei Jahre in Anspruch genommen werden. Einige Kassen werben sogar mit einem früheren Einstiegsalter.
Kann die Diagnose nicht sofort mit dem geschulten Blick gestellt werden, können die mit bloßem Auge verdächtigen Bezirke unter einem Auflichtglas (vergrößert deutlich die entsprechende Hautpartie) genauer betrachtet werden. Ist die Diagnose weiterhin unklar oder fällt eine genaue Differenzierung schwer (zum Beispiel unter den weißen Hautkrebsarten), so kann eine Probe genommen werden.
Dabei ist allerdings Vorsicht geboten. Bei einigen bösartigen Hauttumoren verbietet sich eine Probebiopsie, da dabei die Gefahr der Tumorzellverschleppung gegeben ist. In diesen Fällen sollte der verdächtige Bezirk komplett entfernt und dann histologisch (unter dem Mikroskop) untersucht werden.
Therapie
Die Therapie ist abhängig von der Art des Tumors. Bewährt sich die Mohs-Chirurgie (nach Dr. Mohs), bei der der Arzt während der Operation eine mikroskopische Kontrolle der Wundränder vornimmt. Daneben kommen radiologische, chemotherapeutische und immunologische Therapieansätze zum Einsatz.
Prophylaktisch ist vor allem ein ausreichender Sonnen- und UV-Schutz wirksam. So sollten Hautpartien, wenn möglich, durch Kleidung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, regelmäßig Sonnencreme mit ausreichendem Lichtschutzfaktor genutzt und die direkte Mittagssonne gemieden werden. Da vor allem Kinder auf Grund der reduzierten körpereigenen Abwehrstrategien gefährdet sind, gelten diese Vorsichtsmaßnahmen besonders für sie.
Interessante Themen zum Weiterlesen: Operationen bei Krebs
Verschiedene Arten von Hautkrebs
Schwarze maligne Melanom
Der wohl bekannteste und gefürchtetste Hautkrebs ist das schwarze maligne Melanom, welches nicht selten schon bei Menschen im jungen Erwachsenenalter auftreten kann. Es geht von den pigmentbildenden Zellen der Haut (den so genannten Melanozyten) aus. In seltenen Fällen ist das Melanom nicht pigmentiert (amelanotisches Melanom), was die Diagnose sehr schwierig macht und daher die Prognose deutlich verschlechtert. Melanome sind mit einem Anteil von 1 % aller Hautkrebserkrankungen die seltenste, aber auch die gefährlichste Hauttumor-Form. Trotz der niedrigen Inzidenz fordert der schwarze Hautkrebs die meisten Todesopfer im Vergleich zu ähnlichen Erkrankungen.
Sonderformen sind die Manifestationen an den Schleimhäuten, am Auge (vor allem an der Bindehaut oder der mittleren Augenhaut) oder den Hirnhäuten.
Das maligne Melanom weist unterschiedliche Wachstumsformen auf, welche für die Unterformen namensgebend sind. So wird zum Beispiel ein superfiziell spreitendes mit relativ günstiger Prognose von dem knotigen (nodulären), rasch in die Tiefe wachsenden Melanom abgegrenzt.
Ursache
Die Ursache für den schwarzen Hautkrebs wird in einer vermehrten Sonneneinstrahlung gesehen, jedoch konnte bislang keine Studie diesen Zusammenhang lückenlos belegen. Manche Autoren beschreiben lediglich eine vermehre Nävuszellnävus-Bildung (“Leberflecke”) durch die UV-Exposition und sehen dann diese erhöhte Nävus-Anzahl als Risikofaktor für den schwarzen Hautkrebs an.
Merkwürdig ist auch, dass Melanome häufig an Körperstellen auftreten, die gar nicht soviel Sonnenlicht abbekommen. Das fiel Forschern schon Ende des vorigen Jahrhunderts auf (Sun exposure and mortality from melanoma. UV-Bestrahlung scheint sogar die Chance zu erhöhen, die bösartige Erkrankung zu überleben (Sun exposure and mortality from melanoma).
Viel gefährlicher als die Sonne sind karzinogene Inhaltsstoffe in Sonnencremes. Der Hautschutz wird immer öfter verwendet, weil die Werbetrommel der Hersteller uns mit der Krebsgefahr Angst einjagt (The trouble with ingredients in sunscreens).
Andere Wissenschaftler meinen aber immer noch, die Sonne sei der Hautverursacher. Sie weisen darauf hin, dass vermehrt Hellhäutige und Menschen mit vielen Sonnenbränden in der Kindheit an einem Melanom erkranken. Dem widerspricht eine Studie, die Sonneneinstrahlung mit einem geringerem Krebs-Risiko und höherer Lebenserwartung in Verbindung bringt (Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort).
Ursachen können genetische Erkrankungen (zum Beispiel das Syndrom der dysplastischen Nävi) sein. Spontan auftretende, große und unregelmäßig begrenzte (dysplastische) Nävi erhöhen das Risiko, am schwarzen Hautkrebs zu erkranken.
Diagnose
Die Diagnose wird durch den klinischen Blick gestellt. Als Hilfe für die Einschätzung eines Nävus gibt es die ABCDE-Regel.
ABCDE-Regel
- A für Asymmetrie(je asymmetrischer der Nävus, desto suspekter ist er einzustufen),
- B für die Begrenzung(vor allem eine unregelmäßige Begrenzung ist verdächtig),
- C für Colorit(dabei besteht der größte Tumorverdacht bei uneinheitlichen und schwarzen Färbungen),
- D für Durchmesser(je größer ein Nävus ist, desto mehr sollte er unter Beobachtung stehen) und
- E steht für Erhabenheit(vor allem eine Zunahme der Dicke und eine unregelmäßige Oberfläche sollten Anlass zu einer Untersuchung geben).
Untermauern lässt sich die Diagnose mit dem Auflichtmikroskop, in dem die regelmäßige normale Anatomie und die Pigmentstruktur im Falle einer Erkrankung aufgehoben sind. Eine Gewebeprobe verbietet sich bei einem malignen Melanom auf Grund der hohen Gefahr einer Verschleppung von Tumorzellen. Lieber sollte der Tumor komplett mit ausreichendem Sicherheitsabstand entfernt werden und dann unter dem Mikroskop untersucht werden.
Die Exzision des befallenen Bereichs ist auch der wichtigste Schritt in der Therapie. Dabei wird in der Regel ebenfalls der Wächterlymphknoten (der Sentinel ist der erste Lymphknoten im Abflussgebiet des Tumors) entfernt, um eine lymphogene Streuung zu erkennen. Auch schließt sich nach der Diagnosestellung das Staging an. Dabei werden typische Metastasierungswege und die entsprechenden Zielorgane mittels Ultraschall bzw. CT untersucht, um eine Tumorabsiedlung auszuschließen. Je nach Ausbreitung des Tumors können dann ergänzend Chemo-, Strahlen- und Immuntherapie zum Einsatz kommen.
Die Prognose ist abhängig von dem Ausbreitungsgrad. Je früher der schwarze Hautkrebs entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Allerdings ist zu beachten, dass das maligne Melanom der Hautkrebs mit der höchsten Sterberate ist. So ist bei bereits eingetretener Metastasierung die Prognose infaust.
Nach einer erfolgreichen Behandlung sind regelmäßige Nachkontrollen obligat, um frühzeitig ein Wiederauftreten der Erkrankung entdecken und behandeln zu können.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Basaliom (auch Basalzellkarzinom)
Das Basaliom (auch Basalzellkarzinom) bildet sich aus den Basalzellen der Haut. Dieser sehr häufige Tumor des höheren Lebensalters besitzt so gut wie keine Fähigkeit zu einer Metastasierung, sondern wächst eher lokal destruierend. Daher wird er oft als semimaligne (also “halbbösartig”) eingestuft.
Bei dem Basaliom gilt eine übermäßige UV-Strahlung als gesicherte Ursache für die Entstehung, daher sind die Prädilektionsstellen entsprechend an den sonnenexponierten Stellen zu finden (vor allem im Gesicht, zum Beispiel an der Ohrmuschel, dem Augenbereich oder der Nase). Aber wie bereits oben gesagt: Ich warne davor, die Strahlung generell als schädlich darzustellen. Wir brauchen das Sonnenlicht, um Vitamin D zu bilden.
Als weitere Ursachen werden auch Immundefekte, radioaktive Strahlung, Erbkrankheiten und diverse Schadstoffe als Verursacher diskutiert. Ein bekanntes Beispiel ist das Arsen, das früher zur Behandlung einer Schuppenflechte eingesetzt wurde.
Auch andere Hautkrankheiten (zum Beispiel aus dem Kreis der bullösen Dermatosen) gelten als Risikofaktor, im Laufe des Lebens an einem Basalzellkarzinom zu erkranken.
Dieser semimaligne Tumor wächst in der Regel sehr langsam und ist zuerst völlig schmerzfrei. Daher werden die Basalzellkarzinome von den Betroffenen nicht selten verharmlost. Allerdings weisen Basaliome ein ausgeprägtes lokal zerstörerisches Wachstum auf. Im Verlauf wird neben den Weichteilen selbst das knöcherne Gerüst angegriffen.
Diagnose
Die Diagnose wird meist klinisch durch den geschulten Arzt gestellt. Typisch ist ein hautfarbener (bis leicht pigmentierter) Tumor mit einem aufgeworfenen, perlschnurartigen Randwall. In diesem befinden sich häufig kleine sichtbare Äderchen (so genannte Teleangiektasien). Im Verlauf kann es auch zu einem ulzerierenden, kraterartigen Aussehen kommen. Nur bei diagnostischer Unsicherheit kann eine Probeentnahme zur histologischen Untersuchung sinnvoll sein.
Therapeutisch wird das Basaliom im Gesunden entfernt und dann unter dem Mikroskop untersucht. Da sich dieser Hautkrebs oft nicht sichtbar unter der Hautoberfläche ausbreitet, sind die Krebsränder oft schwer identifizierbar. So sind nicht selten mehrere Nachresektionen notwendig. Dies führt dann zu entsprechend großen Wundflächen. Ist der Tumor in toto entfernt worden, können die Wundhöhlen (welche sich ja auf Grund der Ursache für das Basaliom häufig im Gesichtsbereich befinden) plastisch gedeckt werden.
Ist eine Operation nicht möglich (zum Beispiel bei multimorbiden Patienten oder bei einer ungünstigen Lokalisation des Tumors), können alternativ auch eine lokale Chemotherapie mit Salben, Bestrahlung (auch im Rahmen einer Behandlung mit Psoralenen und UV-A: „PUVA“), Kryotherapie (durch externe Kälteanwendung) oder eine Immuntherapie eingesetzt werden.
Insgesamt ist die Prognose günstig. Jedoch sollten regelmäßige Kontrollen erfolgen, da es nicht selten zu Rezidiven (also einem Wiederauftreten an der ursprünglichen oder einer anderen Stelle) kommt.
Plattenepithelkarzinom (Stachelzellkrebs oder Spinaliom)
Das Plattenepithelkarzinom (auch Stachelzellkrebs oder Spinaliom genannt) geht meist aus einer aktinischen Keratose hervor und ist typischerweise eine Erkrankung der älteren Generation.
Bei der aktinischen Keratose handelt es sich um eine Verhornungsstörung (bei dieser ist eine ausgeprägte Vermehrung der Hornzellen die Folge), die durch vermehrte UV-Exposition im Rahmen von langandauernder Sonneneinstrahlung entsteht – so wird es jedenfalls immer erwähnt.
Seltenere Ursachen sollen chronische Reizungen der Haut (unter anderem durch Wunden, Narben, chronische Hautkrankheiten oder Entzündungen), radioaktive Strahlung, Kontakt zu kanzerogenen Stoffen oder Störungen des Immunsystems sein.
Anzeichen
Das Spinaliom ist ein sehr bösartiger Hauttumor, der sich aus der so genannten Stachelzellschicht (dem Stratum spinosum) bildet. Prädilektionsstellen sind charakteristischerweise die sonnenexponierten Bereiche, wie zum Beispiel die Lippen (häufig bei Menschen, die zusätzlich rauchen), Stirn, Glatze bzw. unter schütterem Haar, übriges Gesicht, Hände und die Unterarme. Aber auch die Geschlechtsorgane sind typischerweise vermehrt betroffen.
Im Rahmen einer aktinischen Keratose bilden sich meist erst kleine rötliche, leicht raue Stellen, welche etwas schuppen können. Diese weiten sich im Verlauf zu großen rot-braunen Knötchen aus, welche typischerweise eine vermehrte Verhornung mit Krustenbildung aufweisen. Auf dieser Entwicklungsstufe kann die aktinische Keratose in ein Plattenepithelkarzinom übergehen (je nach Literatur in bis zu 20 Prozent der Fälle).
Anzeichen für die Transformation sind eine Größenzunahme und eine Verhärtung der Knoten, in einigen Fällen kommt es zu einer schwärzlichen Verfärbung oder zu Ulzerationen. Normalerweise ist ein Spinaliom völlig schmerzfrei. Dieser Tumor ist in der Lage, über den Blut- und Lymphweg Metastasen zu setzen. Glücklicherweise ist eine metastatische Absiedlung relativ selten.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Diagnose
Die Diagnose eines Spinalioms wird ebenfalls klinisch gestellt. Da die aktinische Keratose sowie das Plattenepithelkarzinom der Haut nicht selten schwer von anderen Hauterkrankungen sicher abzugrenzen sind (wie zum Beispiel von einem chronischen Ekzem), sind meist zusätzliche Gewebeproben sinnvoll. Da der invasive Tumor zu einer Streuung in der Lage ist, gehört zu der kompletten Untersuchung auch das Staging. Dabei werden vor allem die im Abflussbereich liegenden Lymphknoten abgetastet. Organe, welche bevorzugt von Metastasen befallen werden, können durch Ultraschall- oder CT-Untersuchungen begutachtet werden, um eine Absiedlung des Tumors auszuschließen.
Therapie
Die Therapie der Schulmedizin ist meist an erster Stelle chirurgisch. Ist dies nicht möglich oder liegt ein ausgedehnter Befall vor, werden lokale Therapien (zum Beispiel eine Chemotherapie in Salbenform, die Kryotherapie, Verdampfung mittels Laser, Peeling oder die PUVA) bevorzugt eingesetzt. Bei einem invasiven Spinaliom im fortgeschrittenen Stadium kann eine systemische Chemotherapie, eine Immuntherapie oder eine Bestrahlung zusätzlich sinnvoll sein.
Insgesamt ist die Prognose bei einem Plattenepithelkarzinom günstig. Wegen erhöhter Rezidivgefahr sind regelmäßige Nachkontrollen obligat.
Lymphome
Deutlich seltener sind die kutanen Lymphome. Lymphome sind bösartige Tumoren, welche von den Lymphozyten ausgehen (dabei handelt es sich um spezielle Immunzellen).
Die Lymphome können überall im Körper auftreten (unter anderem an den Schleimhäuten, inneren Organen, in den Lymphknoten oder an der Haut). Die Formen, die sich in der Haut manifestieren, sind bis zu 80 Prozent kutane T-Zell-Lymphome. Entsprechend sind die B-Zell-Lymphome deutlich seltener. Das häufigste Erscheinungsbild ist die Mycosis fungoides (sie ist trotz des Namens keine Pilzinfektion, sondern weist nur zu Beginn große morphologische Ähnlichkeit auf).
Symptome bestehen neben dem optischen Befund kaum, viele Betroffe klagen lediglich über einen unspezifischen Juckreiz an den betroffenen Hautpartien. Da die Mycosis fungoides nicht selten mit Pilzinfektionen oder banalen Ekzemen verwechselt wird, wird die Diagnose oft erst in späten Stadien gestellt. Dann bilden sich typischerweise größere Knoten, welche auch geschwürig nach außen aufbrechen können.
Eine Streuung der Tumorzellen in den Körper ist möglich. Ist es zu einer leukämischen (also Blutkrebsartigen – Leukämie) Ausbreitung gekommen, spricht der Mediziner auch von dem Sézary-Syndrom.
Das Sézary-Syndrom und die Mycosis fungoides werden mit lokaler, unter anderem chemotherapeutischer Salbenbehandlung und mit (P)UVA-Bestrahlung (dort wird dann vor der Therapie eine UV-sensibilisierende Salbe aufgetragen, was die Wirksamkeit der UVA-Strahlen noch erhöht) behandelt. Bei schweren und fortgeschrittenen Verläufen kommen Chemotherapien und Immuntherapien (zum Beispiel mit Interferonen) zum Einsatz.
Andere Formen des Hautkrebses
Andere Formen des Hautkrebses sind selten. Traurige Berühmtheit hat das Kaposi-Sarkom erlangt, welches fast ausschließlich bei Immunsupprimierten (vor allem im Rahmen einer fortgeschrittenen AIDS-Erkrankung) auftritt. Es wird durch eine Infektion mit dem Humanen Herpesvirus acht (HHV-8) ausgelöst und tritt in der Regel an vielen Körperstellen gleichzeitig auf. Da es sich um einen infektgetriggerten Tumor handelt, besteht die Haupttherapie in einer Behandlungsverbesserung der Grundkrankheit. Auch adjuvante Therapien (zum Beispiel Chemo- und Immuntherapien) werden zusätzlich eingesetzt.
Manche der bösartigen Tumore der Haut gehen von den umliegenden Geweben aus. Aus Bindegewebe entsteht zum Beispiel das Fibrosarkom mit schnellem Wachstum, einer hohen Rate an Metastasierungen und einer insgesamt schlechten Prognose. Lediglich eine großzügige Exzision mit adjuvanter Chemo- und Strahlentherapie gibt Hoffnung auf Heilung. Geht der Krebs von den Muskelzellen aus, so spricht der Mediziner von einem Myosarkom, welches sich in dem Verlauf, der Therapie und der Prognose ganz ähnlich dem Fibrosarkom verhält. Auch bösartige Tumoren von den Gefäßzellen (so genannte Angiosarkome) oder den Sehnen bzw. deren Sehnenscheiden können sich an der Haut manifestieren.
Die Krebsformen, welche aus den Hautanhangsgebilden entstehen, sind eine Rarität. Beispiele sind das Talgdrüsenkarzinom (dieses tritt vor allem am Auge auf), der Schweißdrüsenkrebs und das Merkelzellkarzinom (ein Krebs, welcher aus den Merkel-Tastzellen der Haut hervorgeht).
Übrigens: Wenn Sie so etwas interessiert, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Newsletter
„Hoffnung bei Krebs“ dazu an:
Beitragsbild: 123rf.com – Kateryna Kon
Dieser Beitrag wurde im Oktober 2020 erstellt und letztmalig am 30.07.2024 aktualisiert und ergänzt.




