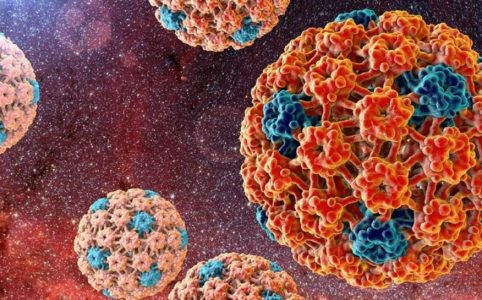Die Leber (Hepar) liegt mit einem Gewicht von ein bis anderthalb Kilo im rechten Oberbauch, direkt unter dem Zwerchfell und in direkter Nachbarschaft zu den Lungenflügeln, dem Herzen, dem Magen und dem Darm.
Es handelt sich um das größte Stoffwechselorgan des Menschen. Es dient unter anderem der Entgiftung, der Speicherung wertvoller Nahrungsbausteine, der Umwandlung von Zucker-molekülen und Fetten in verwertbare Substanzen sowie deren Freisetzung und der Bildung von Bluteiweißen und der Gallen-flüssigkeit zur Unterstützung der Verdauung.
Das Leberversagen beschreibt den vollständigen Funktionsverlust des Organs, wodurch es, ohne sofortige Hilfe, zu weitreichenden Folgen bis hin zum Tod kommen kann. Generell gilt das vollständige Versagen als eher selten, die jährliche Inzidenz in Westeuropa liegt zwischen fünf und zehn Fällen pro einer Million Einwohner.
In anderen Kontinenten, z.B. mit hohem Hepatitis-Aufkommen, ist die Rate deutlich höher. Eine gravierende Störung des Hochleistungsorgans führt zu Schäden oder auch zu einer Zerstörung von Leberzellen (Hepatozyten), das Leberversagen wird daher auch Leberzerfallskoma genannt.
Verschiedene Arten des Leberversagens
Anhand der unterschiedlichen Ursachen lässt sich das Leberversagen in akut (fulminant) und subakut unterteilen. Daneben kann es auch durch chronische Leberschäden (vor allem bei einer Leberzirrhose) zum Versagen kommen.
Das akute (fulminante) Leberversagen wird definiert als plötzlich in Erscheinung tretende, potentiell reversible, progressive (schrittweise fortschreitend) Dysfunktion der Leber, bei der es innerhalb der folgenden vier Wochen auch zu einer Enzephalopathie (Störung der Funktion des zentralen Nervensystems, bei der vor allem ein Hirnödem entsteht = lebensbedrohlicher Zustand) kommt. Zeigt sich diese bereits innerhalb der ersten zehn Tage, spricht der Mediziner von hyperakutem Leberversagen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den “5 Wundermitteln” an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den “5 Wundermitteln” ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Ursachen sind vor allem Virusinfektionen (z.B. mit Hepatitis-Viren, dem Herpes-simplex-Virus, Epstein-Barr-Virus, Zytomegalie-Virus, Varicella-Zoster-Virus), die Überdosierung bestimmter Medikamente, zum Teil in suizidaler Absicht (z.B. Paracetamol, Antibiotika, Antiepileptika, Halothan), die Einnahme von Drogen (z.B. Pilzgifte, Ecstasy), kardiovaskuläre Störungen (z.B. Herzinfarkt, septischer Schock, Thrombose oder Embolie der Vena hepatica), das Reye-Syndrom (verursacht eine deutliche Leberzellverfettung – Fettleber, verursacht zusätzlich eine Enzephalopathie), die Wilson-Krankheit sowie die Schwangerschaftsfettleber.
Das subakute Leberversagen ist die progressive Dysfunktion der Leber, die mit den Symptomen einer Hepatitis einhergeht und im langwierigen Verlauf (nach über vier Wochen bis zu sechs Monaten) zu einer Enzephalopathie führt.
Chronische Lebererkrankungen können in ihrem Verlauf ebenfalls zu einem Totalausfall der Leber führen. Hierbei steht jedoch die Grunderkrankung im Vordergrund, die bereits im Vorfeld verschiedene, schwerwiegende Symptome verursacht.
Den verschiedenen Formen ist gemein, dass die Leber im Verlauf ihre Funktion vollständig einstellt. Die daraus resultierende oder sich zum Teil auch schon vorher präsentierende Symptomatik ist vielfältig.
Das akute Leberversagen setzt meist ohne Vorwarnung (fehlendes Prodromalstadium) ein. Betroffene fühlen sich bis dahin wohl, zeigen keine Anzeichen einer Störung.
Möglich sind ein Ikterus (Gelbfärbung der Haut und Skleren) sowie ein süßlicher Geruch der ausgeatmeten Luft (= Foetor hepaticus), beide Anzeichen können jedoch auch erst im Spätstadium auftreten. Die Leber ist zu Beginn unauffällig, weist im Verlauf eine deutliche Größenzunahme (Hinweis auf Verfettung) auf, die später zurückgeht, bis das Organ unter die normale Größe geschrumpft ist (= nekrotischer Zerfall der Zellen). Die sich entwickelnde Enzephalopathie kann zu Schlafstörungen, depressiven Verstimmungen, einem Konzentrationsmangel, Gedächtnislücken und Schreibstörungen führen.
Weitere Symptome sind eine gestörte Gerinnung (zeigt sich unter anderem durch Einblutungen in die Haut bei Bagatellverletzungen wie z.B. einem leichtem Stoß, daneben aber auch inneren, nicht sofort erkennbaren Blutungen) sowie eine Anreicherung des Organismus mit Ammoniak (NH3). Auch der Zuckerhaushalt gerät in Mitleidenschaft. Die fehlende Regulation führt durch einen gesteigerten Glukoseabbau zu einer Unterzuckerung (Hypoglykämie) mit drohendem Schock (Bewusstseinsverlust).
Das Leberversagen verursacht, neben den verschiedenen Symptomen, Komplikationen, die hauptverantwortlich für die erhöhte Letalität sind. Bei der Enzephalopathie ist es das Hirnödem (siehe auch allg. Ödeme), welches ohne geeignete Therapie in 50 bis 80 Prozent der Fälle zu einem frühzeitigen Lebensende führt.
Die verminderte Synthese von Gerinnungsfaktoren verursacht schwere Blutungen. Bei den kardiovaskulären und pulmonalen Komplikationen machen sich vor allem die veränderte Gefäßsituation, daraus resultierend die Unterversorgung des Körpers mit Sauerstoff (Hypoxie) sowie ein drohendes Lungenödem (mit stark eingeschränkter Atmung) bemerkbar.
Daneben kommt es vermehrt auch zu einem Versagen der Nierenfunktion. Durch das geschwächte Immunsystem (z.B. durch mangelhafte Bildung der Komplementfaktoren) drohen Infektionen, in über 80 Prozent ist ein bakterieller Befall nachweisbar.
Diagnose
Kommt es bereits in der Frühphase zu deutlichen Symptomen (Ikterus, süßlicher Geruch), kann die Diagnose rasch gestellt werden. Fehlen diese jedoch, muss der Arzt verschiedene Untersuchungsmethoden anwenden, wobei der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle spielt.
Zum Teil weist das Blutbild oder Blutwerte eine Transaminasenerhöhung (spezielle Enzyme) auf. Daneben erfolgt z.B. der Nachweis fehlender Gerinnungsfaktoren oder auch die Differenzierung der Ursache.
Die Leber wird sonographisch dargestellt, weitere bildgebende Verfahren sind unter anderem das Röntgen (z.B. der Lunge), die CT (vor allem des Schädels) und die MRT. Auch zerebrale Funktionsstörungen werden bei der Diagnostik mit berücksichtigt.
Therapie
Die Therapie muss so zügig wie möglich einsetzen. Hierzu ist eine intensivmedizinische Betreuung notwendig. Zum Teil werden die Betroffenen sediert, um den gesamten Organismus zu schonen.
Die Ernährung erfolgt parenteral (Umgehung des Magens) über Infusionen, über eine Magensonde oder PEG-Sonde (perkutane endoskopische Gastrostomie). Das Hirnödem (als Haupttodesursache) muss unter stetiger Überwachung bleiben, zur Hirndruckmessung wird eine Sonde eingelegt, durch Senkung der Körpertemperatur kann das Ödem unter Umständen verkleinert werden.
Die Gerinnung wird durch geeignete Präparate stabilisiert, ein Bakterienbefall antibiotisch bekämpft. Zusätzlich erfolgt die Gabe von Sauerstoff, Anreicherungen, z.B. von Ammoniak, werden medikamentös behandelt, der Zuckerhaushalt über Infusionen reguliert.
Alle Maßnahmen dienen der Erhaltung und Stabilisierung des Lebens, einmal geschädigtes Lebergewebe (Nekrosen) kann sich nicht regenerieren. Daher muss das Organ meist nach dem Versagen ersetzt werden (Lebertransplantation).
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter “Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.” dazu an:
Beitragsbild: 123rf.com – subbotina
Dieser Beitrag wurde letztmalig am 19.07.2012 aktualisiert.