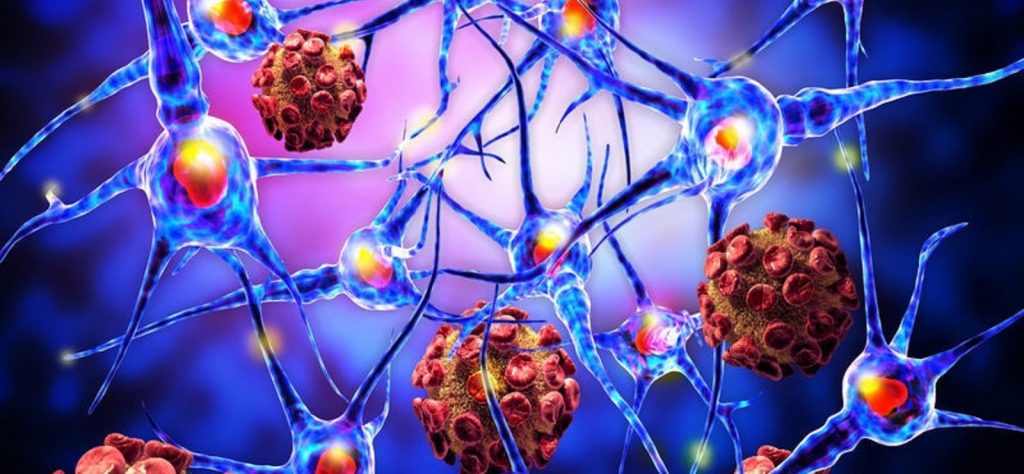
Diphtherie: Ansteckung, Symptome, Verlauf
Die durch das Corynebacterium diphtheriae hervorgerufene Diphtherie ist eine meldepflichtige Erkrankung, die sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen in Erscheinung tritt.
Ein Befall im Säuglings- und Kleinkindalter ist dabei wesentlich häufiger zu beobachten, da viele Erwachsene durch vorausgegangene Kontakte bereits eine Immunität entwickelt haben.
In Westeuropa ist die Inzidenz stetig abnehmend, wodurch die Diphtherie mittlerweile zu den seltenen Krankheiten gezählt werden kann. Bei Kindern kann das Bakterium lebensbedrohliche Symptome verursachen, weshalb eine prophylaktische Impfung im ersten Lebensjahr sinnvoll erscheint.
Die Diphtherie tritt gehäuft in Wintermonaten und dann vor allem in Ländern mit geringem Hygienestandard und mangelhafter medizinischer Versorgung auf. Hier kommt es nicht selten zu einer epidemieartigen Ausbreitung.
Ansteckung
Die Übertragung des Bakteriums erfolgt über Tröpfcheninfektionen, z.B. durch Niesen oder Sprechen. Dabei können auch Menschen als Verursacher gelten, die das Bakterium in sich tragen, jedoch keine Symptomatik entwickeln (immun sind). Nach einer Inkubationszeit von zwei bis sechs Tagen zeigt sich das typische Beschwerdebild. Mit Ausbruch der Erkrankung ist die betroffene Person ansteckend für ihr Umfeld und muss so lange isoliert werden, bis kein Bakterium mehr nachweisbar ist.
Symptome
Früher wurde die Erkrankung bei Kindern, bedingt durch die Symptomatik, als „Würge-Engel“ bezeichnet. Das Corynebacterium diphtheriae befällt vornehmlich die Schleimhäute von Mund, Rachen und Kehlkopf (daneben auch die Nase oder die Bronchien), wo es ein lebensbedrohliches Gift (Endotoxin, eines der stärksten biologischen Giftstoffe) entwickelt, welches das befallene Gewebe schädigt, Zellen zerstört.
Das Gift gelangt über den Blutweg zu den inneren Organen, hier kann es zu schweren Folgeerkrankungen kommen.
Klassisches Merkmal einer Diphtherie ist der süßlich-faulige Mundgeruch der betroffenen Person. Durch den Bakterienbefall entwickeln sich Kopfschmerzen und Halsschmerzen, vielfach einhergehend mit deutlichen Schluckbeschwerden oder einer Heiserkeit. Die regionalen Lymphknoten sind geschwollen, der Rachenbereich weist einen graugelben Belag auf. Zusätzlich treten mäßiges bis hohes Fieber, ein bellender Husten, Atemnot und Erkältungssymptome (z.B. laufende Nase) in Erscheinung. Schwere Formen führen zu einem blutig-eitrigen Ausfluss aus der Nase. Die erkrankte Person weist einen fahlen, blassen Hautton (Blässe) auf, wirkt matt, erschöpft, kraftlos. Gerade Säuglinge und Kleinkinder sind kaum in der Lage, ihren Allgemeinzustand (z.B. Bauchschmerzen und Gliederschmerzen) dem Umfeld gegenüber explizit zu äußern, hier ist eine gute Beobachtung der Eltern wichtig, um frühzeitig reagieren zu können.
Bei Erwachsenen zeigen sich die gleichen Symptome, jedoch treten diese durch eine meist gut ausgebildete Immunabwehr zum Teil nur in abgeschwächter Form auf.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilpflanzen-Newsletter dazu an. Darin geht es im Wesentlichen um Heilpflanzen, aber auch um Bachblüten oder Homöopathische Mittel:
Verlauf
Zu Komplikationen bzw. einem raschen Lebensende kann es immer dann kommen, wenn die Erkrankung nicht frühzeitig erkannt und behandelt wird. Es drohen der Erstickungstod durch die zunehmende Atemnot sowie das Versagen lebensnotwendiger Funktionen. Das Gift breitet sich über das Blut aus und schädigt dabei vor allem das Herz (Entzündung), die Nieren, die Leber, Nervenfunktionen (Lähmungserscheinungen) sowie Gefäße.
Der Arzt kann meist bereits anhand des Mundgeruchs und der geschwollenen Lymphknoten eine erste Vermutung wagen. Zusätzlich erfolgt die eingehende Inspektion des Mund-Rachenraums. Hier zeigen sich die Belege auf der Schleimhaut und den Rachenmandeln, die bei Ablösen meist Blutungen verursachen. Die Auswertung eines Abstrichs (Mikroskop, Bakterienkultur) oder auch des Blutbildes liefert den gesicherten Erregernachweis.
Therapie
Bakterien werden generell mit einem Antibiotikum behandelt. Bedingt durch das starke Gift, welches sich bei Befall entwickelt, reicht diese Therapie bei der Diphtherie nicht aus. Hier muss unverzüglich ein Gegengift (Antitoxin) verabreicht werden, um das Bakterium aufhalten zu können. Durch das zusätzlich verordnete Antibiotikum (z.B. Penicillin) wird die Ausbreitung des Bakteriums verhindert.
Neben der medikamentösen Therapie muss die erkrankte Person über den gesamten Zeitraum der Infektiösität isoliert bleiben, anschließend ist das Isolierzimmer vollständig zu desinfizieren. Die stationäre Behandlung erfolgt bei drohenden Komplikationen. Dies gewährleistet ein rasches Eingreifen, z.B. die künstliche Beatmung bei Luftnot.
Bei frühzeitiger Therapie sind die meisten Beschwerden nach gut einer Woche überstanden. Eine Immunität wird dabei nicht erzielt, wodurch die Erkrankung in späteren Jahren bei erneutem Virenbefall wieder auftreten kann. Die prophylaktische Impfung bietet einen Schutz für ca. fünf Jahre und sollte in diesen Abständen erneuert werden.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Beitragsbild: 123rf.com – ralwel




